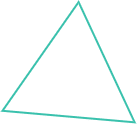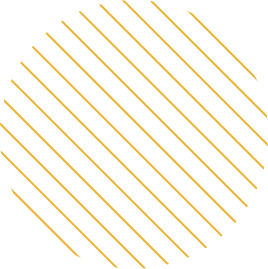Eine Bemerkung vorneweg: Ich schildere meine persönlichen Eindrücke, es mag nicht alles auf genauen Fakten beruhen, doch auch persönliche Beobachtungen können zum Verständnis beitragen.
Vielleicht ist es für einige schon wieder ein ganzes Stück aus dem Blickfeld gerückt, doch hier ist die Nicaragua-Krise vom April immer noch deutlich präsent. Es fällt ja auch wirklich schwer, bei der Flut an Krisen auf der Welt einen Überblick zu behalten. Außerdem scheint es aus deutscher Perspektive furchtbar weit entfernt. Während ich täglich mit meiner Gastfamilie vor den Nachrichten sitze und von neuen Protesten und Flüchtlingsströmen höre, sucht man in Deutschland vergeblich nach Informationen.
Auslöser der Krise war im April eine Rentenkürzung, um das zweitärmste Land der Welt zumindest teilweise vom Schuldenberg zu befreien. Jahrelang hatte Venezuela Nicaragua mit Öl im Gegenwert von etwa 550 Millionen US-Dollar im Jahr versorgt. Seit aber Venezuela selber in der Krise steckt und dieser Geldhahn zugedreht ist, fror das Wirtschaftswachstum nahezu ein und die Arbeitslosigkeit stieg ins Unermessliche. Der Präsident sah in einer Sozialreform die einzige Möglichkeit. Für die Menschen bedeutete das allerdings eine Katastrophe. Viele von ihnen zog es auf die Straße und schon bald wurden aus den Protesten gegen die gekürzten Renten Demonstrationen für ein demokratischeres Nicaragua. Denn eine Besserung der Wirtschaftslage ist mit einem autoritären Staatsoberhaupt, das nicht nur seine Frau als Vizepräsidentin, sondern auch sieben seiner Kinder in Regierungsämtern untergebracht hat, kaum denkbar.
Um die Proteste klein zu halten, nutzte die Regierung Schusswaffen und so kletterte die Zahl der Toten jeden Tag ein bisschen weiter nach oben. Jeden Abend saß ich damals gebannt vor den Nachrichten und verfolgte die immer neuen Meldungen. Denn eigentlich lautete mein Ziel für den Freiwilligendienst genauso wie für drei meiner Mitfreiwilligen: Nicaragua. Zuerst habe ich versucht, mir die Situation kleinzureden, doch als Weltwärts alle aktuellen Freiwilligen zurückholte und das Abflugdatum immer näher rückte, wurde es immer verständlicher, warum auch irgendwann unsere Organisation die Reißleine zog. Das Risiko einer Ausreise war einfach nicht tragbar. Für mich hieß es neuerliches Schreiben von Bewerbungen und weitere Gespräche. Doch ich hatte riesiges Glück. Innerhalb von einer Woche hatte ich eine neue Organisation, ein spannendes Projekt und sogar schon den Kontakt zu meiner Gastfamilie. Und dann auch noch im Nachbarland, Costa Rica. Da es immer als Schweiz Lateinamerikas bezeichnet wurde, machte ich mir um drohende Konsequenzen der Unruhen im Nachbarland keine Sorgen. Im Nachhinein betrachtet war das ziemlich naiv. Doch das denke ich mir hier nun häufiger. Es ist eben ein Prozess des Lernens und Verstehens.

Konfrontiert wurden wir mit der Flüchtlingssituation in Costa Rica das erste Mal beim Einführungsseminar vor Ort. Die Einheimischen machten uns klar, dass sich die Sicherheitslage extrem verschärft hätte. Den Erklärungen, dass ein Tico nie einen Touristen angreifen würde, weil er weiß, wie sehr Costa Rica von Ihnen lebt, ein Nicaraguaner hingegen schon, wollte ich keinen Glauben schenken. Verstand aber wohl, dass dieser kleine Staat durch die an der Einwohnerzahl gemessenen „vielen“ Flüchtlinge deutlich überfordert ist. Am eindrücklichsten merkten wir das bei unseren beiden Besuchen bei der Migración (Einwanderungsbehörde) für unser permanentes Visum. Schon vor dem Eingang teilten sich die Menschenmassen in Flüchtlinge und alle anderen, und schon um eine Stunde vor regulärer Öffnung waren die Schlangen unendlich lang. Als wir uns zu Beginn falsch einordneten wurden wir schnell als Falschläufer erkannt und mit einem Grinsen „Ach die Gringo-Touristen schon wieder“ in die andere Schlange befördert. (Gringo ist das Tico-Wort für US-Amerikaner, und als blonder Tourist muss man ja zwangsläufig aus den USA kommen).
Ich lernte die deutsche Bürokratie plötzlich richtig schätzen. Denn es herrschte Chaos und immer wieder gab es neue unpräzise Aussagen. Doch wir warteten freiwillig und ohne Druck, wie schlimm muss es für die Menschen sein, die ihre Heimat verlassen müssen, weil nicht nur die finanzielle, sondern auch die humanitäre Situation nicht mehr aushaltbar ist? Und dann in ein Land, das sich wegen Grenzstreitigkeiten mit seinen Nachbarn nicht unbedingt auf dem grünsten Zweig befindet. Umso erlöster war ich nach den ersten Eindrücken, als ich beim Sonntagsspaziergang mit meiner Gastfamilie ein paar Wochen später ein Refugees-Welcome-Graffiti entdeckte.
Für mich ist der Kontakt mit Nicaraguanern Alltag und der Umgang mit den Folgen der Migration ein wesentlicher Teil meines Projektes. Denn Transforma gibt Frauen aus extrem armen Verhältnissen, meist Flüchtlingen aus Nicaragua, durch verschiedenste Bildungsangebote (Nähen, Massage, Maniküre, Englisch, Empreneurship) und einer großen Portion Selbstvertrauen, eine Zukunft. Die Transformierungsgeschichten der Frauen sind eindrucksvoll und nach und nach ziehen sie auch mich ins Vertrauen und ich freue mich ihnen zuhören zu dürfen. Transforma ist ein Platz gefüllt mit so viel Liebe und Miteinander, dass man schnell vergisst, aus was für Verhältnissen die Frauen kommen. Einige nehmen bis zu vier Stunden Anfahrtsweg auf, nur um einen Kurs zu besuchen. Außerdem sind gerade die Nicaraguanerinnen unheimlich aufgeschlossen und wir fühlten uns sogleich verbunden, weil wir die Erfahrung teilen, in einem fremden Land zu leben. Eine Frau erzählte mir zum Beispiel letztens von Weihnachten. In Nicaragua scheint es wohl ein fröhliches lautes Familienfest zu sein, bei dem man auf der Straße tanzt und feiert. In Costa Rica sucht man anscheinend diese Freude vergeblich, die Leute verstecken sich in ihren Häusern und bleiben unter sich. Jedes Jahr aufs Neue sehnt sie sich nach der Fröhlichkeit Nicaraguas.
Die letzten Wochen war eine meiner Aufgaben, eine Art Statistik aufzustellen, wie viele Frauen häusliche Gewalt erfahren mussten, wie viele keine 3 Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen können, wie viele nicht einmal die Grundschule beendet haben oder wie viele junge Mütter sind. Die Zahlen waren erschreckend und mir wird immer wieder bewusst, was für ein Privileg mir zu Teil wurde, ein so behütetes Leben zu leben. Besonders aufwühlend war ein Besuch in einem der Slums. Im Valle Central, in dem ¾ der Bevölkerung Costa Ricas leben, gibt es davon leider einige. In einem der Armutsviertel finden so viele Nicaraguaner eine Bleibe, dass es von den Ticos schon „kleines Managua“ genannt wird. In San José Central gibt es extra „Nica-Cafés“ und Läden mit nicaraguanischen Spezialitäten. Die Integration läuft schleppend, die verschiedenen Landsleute bleiben lieber unter sich. Da ich die Akzente nicht unterscheiden kann, ist es mir schon häufiger passiert, dass ich ins Fettnäpfchen getreten bin. So war ich mit einer Gruppe von Deutschen und Einheimischen unterwegs. Zur Verabschiedung gab es von den Deutschen eine Umarmung, die von den anderen durch ein Küsschen auf die Wange erweitert wurde. Ich war einen kurzen Moment überrascht und sagte: „Ah, eso es Costa-Ricense!“ sofort wurde ich verbessert, die beiden Jungs lebten zwar schon seit Jahren hier, der nicaraguanische Nationalstolz war aber noch längst nicht verblasst.
Gleich in meiner zweiten Woche stand ein Besuch in einem der sogenannten Triangulos an. Der Anlass war der Kindertag und zusammen mit zwei anderen Mitarbeiterinnen von Transforma, ihren Angetrauten und zwei großen Säcken voller Geschenke machten wir uns auf den Weg. Das Auto wurde sicherheitshalber ein paar Straßen entfernt geparkt und die Wertsachen versteckt. Einziges Utensil war meine Kamera mit der wir die ganzen Kinderlachen festhalten wollten. Und wie dankbar waren die Familien für diese Aufmerksamkeit. Auch wenn mir ganz flau im Magen wurde, als privilegierter Weißer in einen Slum zu marschieren, ein paar Geschenke zu verteilen und die mit den niedlichen Kindern für Selfies zu posieren, fühlt sich definitiv nicht richtig an. Verändern kann man dadurch nämlich so gut wie nichts, nur für ein paar Minuten Träume erzeugen.