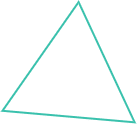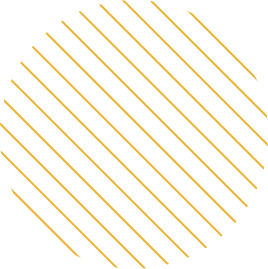Wenn man über das weltwärts-Programm ausgeschickt wird, werden vom BMZ natürlich auch Ansprüche an den Freiwilligen gestellt. Da wären das Spendensammeln zu Beginn des Freiwilligendienstes, aber auch die Erwartung, sich nach seinem Freiwilligenjahr zu engagieren und entwicklungspolitisch weiterzubilden. In erster Linie macht sich ein frischgebackener Freiwilliger natürlich Sorgen um die Spendensumme, die gar nicht so einfach zu beschaffen ist. Über den zweiten Punkt, die Bereitschaft, sich vollkommen auf das Thema der Entwicklungshilfe und der internationalen Beziehungen einzulassen, denkt man zu Beginn nicht groß nach. Man liest zwar den Punkt seines Vertrages durch, in dem man dazu aufgefordert wird, sich nach Beendigung des Dienstes weiter ehrenamtlich zu betätigen, aber naja, leere Worte. Das wird man schon irgendwie machen, klar, dass das Ministerium das schreiben muss.
Dass sich meine Interessenslage, meine Lebenseinstellung und Mentalität so grundlegend ändern würde, hätte ich deshalb nie erwartet. Besonders nicht angesichts des pandemie-bedingten Freiwilligenabbruchs nach nur sieben Monaten. Und doch: Inzwischen bin ich an meinen Studienort gezogen und über meinem Schreibtisch hängt das Ergebnisdokument der Vereinten Nationen der Weltkonferenz über indigene Völker gleich neben einem Schema zur Definition nachhaltiger Gemeinschaften.
Atiycuy Perú
Die sieben Monate meines Freiwilligenjahres verbrachte ich in Peru. Im Projekt „Atiycuy Perú“ arbeitet man nicht nur mit der lokalen Dorfgemeinschaft, man verbringt auch außerhalb der Arbeit sehr viel Zeit mit den dort lebenden Yanesha. Ob es nun Ausflüge am Wochenende mit Carlos und Cely, dem Yanesha-Pärchen aus unserem Team, Übernachtungen in den indigenen Dörfern oder Besuche bei Meda sind. Meda betreibt einen kleinen Yanesha-Kunsthandwerksladen in unserer Kleinstadt. Und sie bringt uns gern bei, wie wir unseren eigenen Schmuck herstellen können, indem wir die selben Samen wie die Yanesha nutzen. Diese Samen werden nicht irgendwo gekauft, die Yanesha sammeln sie in den Bergen. Edlinda, eine bezaubernde Omi in einem der Dörfer erzählte mir einmal, dass ihr Mann für ein kleines Säckchen roter Samen (also ungefähr 100g) häufig 3 oder 4 Tage auf Suche ist.

Die Indigenen- Gemeinschaft
Die Begegnungen mit den Yanesha hielt für mich sehr gegenteilige Erfahrungen bereit. Gegenteilig, im Leben einer dort lebenden Person jedoch gleichsam real und ganz normal. Zum einen ist da die offene, selbstlose und fröhliche Mentalität, mit der die Yanesha miteinander und mit Fremden umgehen. Die Bezeichnung „Comunidad Nativa“ heißt übersetzt nicht etwa „Indigenen-Dorf“, sie bedeutet „Indigenen-Gemeinschaft“. Und es ist ebendiese Gemeinschaft, die das Leben der Yanesha prägt. Carlos erzählte mir, dass sobald ein Yanesha ein Haus für sich und seine Familie bauen will, das ganze Dorf mit anpackt und das Haus innerhalb von nicht einmal sechs Wochen steht. Das ist Gemeinschaft. Im erschreckenden Kontrast zu diesen liebenswerten Menschen, von denen wir alle sehr viel lernen können, stehen ihre Erfahrungen mit Nicht-Indigenen. Bei Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche angefangen erleben die ursprünglichen Völker Perus Diskriminierung in allen Lebensbereichen. Von Beschimpfungen, Landraub und Diebstahl über die Abweisung des Krankenhauses bei Tumorerkrankungen hin zu Terrorismus. In den 90er Jahren wurden 330.000 peruanische Indigene zwangssterilisiert, um sie so langsam auszurotten.
Wenn man diese Geschichten erzählt bekommt, weiß man meist nicht, wie man reagieren soll. Man fühlt Unglauben, Mitleid, Trauer, Wut kommt auf. Und man schämt sich. Obwohl man persönlich nicht verantwortlich ist. Aber Scham habe ich trotzdem häufig empfunden.

Und plötzlich begreift man: Wir sind alle verantwortlich. Nicht nur aus historischer Sicht. Aber eine andere Sache habe ich auch verstanden: Ich habe eigentlich keine Ahnung, was in der Welt so los ist. Ich halte mich für einen sehr politisch interessierten Menschen, hatte überlegt, Politikwissenschaften zu studieren. Aber nun sehe ich mich mit dem Fakt konfrontiert, eigentlich keinerlei Einblick in viel zu viele Bereiche der Politik und ihre Auswirkungen zu haben. Der Schock dieser Erkenntnis hat mich dazu gebracht, nun, Zuhause, mit Zugang zu Büchern und dank Corona auch mit genug Zeit, viel zu recherchieren und mich weiterzubilden. Angefangen mit Erfahrungsberichten aus den Jahren der Zwangssterilisierung und Büchern über Kolonialismus bereite ich im Moment einen Workshop über nachhaltige Entwicklungshilfe für den neuen Freiwilligenjahrgang vor. Und das Seminar zum Indigenenrecht, das ich vor gut einem Monat vorbereitete, hielt weitere Enttäuschungen bereit. So sind die wirklich wichtigen, umfassenden Dokumente zum Indigenenrecht nicht bindend. Natürlich nicht. Ich lese Berichte über die Umsetzung des Indigenenrechts und habe das Gefühl, je weiter man gräbt, desto schlimmer wird es. In diesem Fall stimmt es wohl. Ungebildet lebt man glücklicher. Aber trotz allem fühle ich mich verpflichtet, mich zu informieren, alles Wissen in mich einzusaugen, alles zu lernen, was man lernen kann, um eines Tages vielleicht wirklich einen Unterschied zu machen.
Und schlussendlich, obwohl ich das anfangs wohl nicht erwartet hatte, erfüllt man die Erwartungen des Ministeriums.