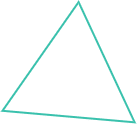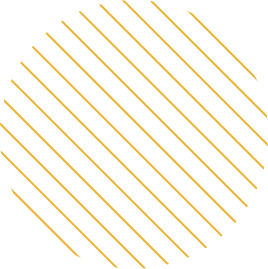Seit fast vier Monaten lebe ich jetzt hier in diesem kleinen Städtchen mit den staubigen Sandstraßen und den kleinen halbverfallenen Häusern, zwischen denen auf Kopfhöhe Stromkabel hängen und Hunde vor kleinen Gemüse- und „Krimskrams“- Läden schlummern. Fast vier Monate… Mir kommt es gleichzeitig vor als würde ich wenige Wochen oder aber bereits ein Jahr hier leben und jede Woche über holprige Straßen in die indigenen Gemeinden (Comunidades) fahren, um dort mit den Yaneshagemeinschaften zu arbeiten, in Villa Rica Klimamärsche oder ein interkulturelles Camp mit allen Kindern des Kinderpatenprogramms, aus den Comunidades und aus Villa Rica, organisieren, oder an einem Seminar zur Erarbeitung einer Yaneshaverfassung teilnehmen. Wir vier Freiwilligen, Lisa, Yuki, Yvonne und Ich wurden auf die vier Teilbereiche unseres Projektes verteilt, um schwerpunktmäßig in verschiedenen Bereichen, die aber in einander greifen, zu arbeiten. So ist Yvonne Teil des Programms „COBIO“, dem Programm, das sich dem Schutz des Atiycuy- Naturschutzgebietes widmet, Yuki dagegen arbeitet mit Mundi in der Begleitung der Yaneshagemeinschaften in ihrem Organisationsprozess (dazu gehört unter anderem auch das Entwerfen einer Verfassung oder verschiedene Workshops zu indigenen Rechten) und Lisa arbeitet im Umweltbildungsprogramm, das zum Beispiel Workshops mit den Jugendlichen aus Villa Rica oder mit den Kindern aus den indigenen Gemeinschaften zu einheimischer Flora und Fauna oder zum Naturschutz veranstaltet.

Ich dagegen unterstütze Angelika und Henry im Kinderpatenprogramm, wo wir sowohl mit den Kindern aus Villa Rica, als auch aus den indigenen Gemeinschaften („Comunidades“) arbeiten. Mit den Kindern machen wir verschiedenste Übungen zur Förderung ihrer persönlichen Entwicklung, und zumindest in den Comunidades auch zur Stärkung ihrer kulturellen Identität. So wie letzte Woche, als wir zum Beispiel Yaneshamuster malten, oder die Kinder zum Jahresabschluss traditionelle Tänze aufführten, die sie in der Schule gelernt haben. Ich liebe es nach den Workshops mit den Kindern im Fluss zu schwimmen oder ihnen ein paar Worte Englisch bei zu bringen, nach denen sie mich mit unglaublicher Neugier fragen, fast so sehr wie das Strahlen in ihren Augen zu sehen, wenn sie auf Yanesha ein Lied vorsingen, oder mir versuchen bei zu bringen, wie man Carachamas (Panzerwelse) im kristallklaren Fluss fängt.Beinahe vier Monate leben und arbeiten wir jetzt hier, und langsam habe ich das Gefühl, das dieses Städtchen zwischen Kaffeplantagen und Bergregenwäldern fast zu einem zweiten Zuhause für mich geworden ist.Und dennoch gibt es immer wieder diese kurzen Momente, in denen ich auf einmal bemerke, wie anders doch alles ist. Ich gehe durch die staubigen Sträßchen, vorbei an ausgemergelten Straßenhunden, die vor kleinen Holzschuppen schlafen, vorbei an klappernden Mototaxis und mit Lautsprechern durch die Stadt fahrenden Churrosverkäufern. Am Straßenrand sitzen einige alte Damen in ausgeblichener andiner Tracht, vor ihnen mehrere Töpfe aus denen sie „Masamora“ und Milchreis schöpfen, um irgendwie etwas Geld zu verdienen.

Eine alte Frau spricht mich an, bettelt um ein paar Soles und ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich biege ab. Plötzlich bin ich in einer kleinen Seitenstraße. Kinder in löchrigen, dünnen Kleidern spielen im Staub zwischen den kleinen Hütten. Ein paar von Ihnen kenne ich aus den Mittwochsworkshops. Was diese Kinder alles erleben mussten. Der Vater im Gefängnis, weil er die große Schwester vergewaltigt hat, die Mutter krank, kann nicht arbeiten. Eine Großmutter, die ihr Essen den Kleinen gibt, weil das Geld nicht reicht, um Reis zu kaufen. Die Eltern Tagelöhner auf den Feldern. Kinder, die Obst bei den Nachbarn klauen, sich mit Waschmittel waschen, weil das Shampoo zu teuer ist. Wir können uns nicht vorstellen, wie es ist so zu leben. Abends mit knurrenden Mägen ins Bett zu gehen, von anderen diskriminiert zu werden, weil man alte Klamotten trägt oder sich Schulmaterialien nicht leisten kann. Wir können es uns nicht vorstellen und zu oft verschließen wir die Augen, aus Hilflosigkeit, aus Ignoranz, aus Egoismus. Ich weiß es nicht. Ich selbst merke, wie schwer es mir fällt mich in ihre Lage zu versetzen, zu handeln und nicht wie so oft weg zu sehen, die Augen zu verschließen, vor dem Leid der Anderen. Es ist 5.30 und wir fahren in eine der Comunidades. Auf dem Weg dorthin fällt mir immer wieder auf, wie viel Müll hier am Straßenrand liegt. Was für ein Kontrast zu der Lebensweise der Yanesha, die traditionell zusammen mit und in der Natur leben. Nach einer Stunde Wanderung kommen wir komplett verschwitzt in diesem kleinen Dorf an, und ich fühle mich für einen Augenblick wie in der Zeit zurückversetzt, wie in einer anderen Welt. Genauso wie ich mich fühlte, als die Yanesha an ihrem Jubiläum um das Lagerfeuer tanzten begleitet von Panflötenmusik und traditionellen Gesängen oder, wenn die Kinder einem am Fluss versuchen beizubringen, wie man mit den Händen Carachamas (Panzerwelse) fängt. Doch diese Momente sind nur noch Ausnahmen, selbst in den sehr besonderen Gemeinschaften, mit denen wir arbeiten, die im Gegensatz zu vielen ihre Kultur noch nicht aufgegeben haben. Doch auch hier verlieren die Leute immer mehr ihre Traditionen, ihre Sprache, ihre Kultur, die bald auszusterben droht. Mein Blick streift über die kleinen Hütten mit Palm- oder Wellblechdächern, zwischen denen Hühner im Staub scharren und Kinder von den Bäumen Früchte pflücken. Ein kleines Mädchen, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, kommt auf mich zu. Auf ihrem Arm trägt sie ihren gerade mal zwei Jahre alten Bruder. Die Eltern sind Kleinbauern oder arbeiten im nächsten Dorf, um ein paar Soles zu verdienen, während ihre kleinen Kinder zuhause bleiben, um auf ihre kleinen Geschwister aufzupassen. Wie kümmert sich ein sechs jähriges Kind um seinen zwei jährigen Bruder, wenn es doch zur Schule gehen soll? Was passiert mit einer Familie, wenn die alleinerziehende Mutter plötzlich nicht mehr als Tagelöhnerin auf der Plantage arbeiten kann, kein Geld mehr verdient, um Lebensmittel oder Medikamente zu kaufen? Viele Familien ziehen in die Städte, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen, irgendwann. Sie leben in der Stadt, um dort Arbeit zu finden, oder, damit ihre Kinder studieren können, doch mit dem Umzug in die Stadt verlieren viele ihre Kultur. Sie kommen nach Lima, Huancayo oder Villa Rica und werden statt mit offenen Armen mit Beleidigungen begrüßt. Sie wären „chunchos“ (das heißt so viel wie „Wilde“), könnten nichts, wären niemand. Kinder, die in Kushmas (die traditionellen Gewänder der Yanesha) zur Schule kommen, werden als Hexe bezeichnet, ausgelacht, ausgegrenzt. Kein Wunder, dass viele Familien ihre Kultur nicht mehr weitergeben.Hier in Villa Rica liegt die Kolonialisierung nicht lange zurück. Die Dorfältesten haben noch miterlebt, wie die deutschen Siedler kamen, um ihnen alles zu nehmen. Doch bis heute sind sie Opfer von Diskriminierung, der Ausbeutung, dem Landraub. Was früher Kautschuk war ist heute Erdöl, das mit großen Tanklasterkarawanen aus dem Regenwald transportiert wird.

Schaut man sich die Situation der Menschen hier an, wird klar warum die Arbeit so vielseitig ist. Es muss nicht nur mit den Kindern gearbeitet, sondern auch mit Behörden verhandelt werden, die Yaneshagemeinschaften müssen aufgeklärt, organisiert und unterstützt werden, um illegalen Landraub zu verhindern, und den Regenwald vor dem Absterben zu bewahren. 3500 Jahre. So lange hat die faszinierende Kultur der Yanesha überlebt, doch wer weiß wie lange es sie noch geben wird. Ich beobachte die Kinder, wie sie ihre Geschwister über die Felder tragen. Denke an die Familien, mit denen wir hier arbeiten, an Familien, die abends kein Essen auf den Tisch bringen können, während wir in Deutschland massenweise Lebensmittel wegwerfen. Wie kann es sein, dass Menschen noch immer aufgrund ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert werden, im Krankenhaus heimgeschickt werden, ihre Kultur verleugnen, nur weil sie anders sind? Wie kann es sein, dass Gemeinschaften ihr Land geraubt wird, um Öl aus dem Boden zu holen, Holz zu schlagen oder Ananasfelder zu schaffen, ohne nur einmal die Betroffenen zu fragen? Was ist unsere Rolle in all diesen Dingen? Sind es nicht auch wir, die billige Früchte wollen, die immer mehr Erdöl fordern, um unser Leben im Luxus zu ermöglichen? Viel zu oft verzetteln wir uns in den Problemen unserer kleinen Alltagswelt, unseres Staates, unseres eigenen kleinen Tellerrandes, ohne auch nur ansatzweise zu schätzen zu wissen, wie gut wir es eigentlich haben. Dankbar zu sein, dafür in einem Staat zu leben, ohne Politiker, die reihenweise hinter Gittern sitzen, wegen Korruptionsvorwürfen. Dankbar zu sein, dass wir eine Krankenversicherung haben, durch die wir im Notfall eine ärztliche Behandlung erhalten können, und nicht aus Geldmangel in Lebensgefahr schweben. Dankbar zu sein, für die Möglichkeit entscheiden zu können, was wir essen, sogar so sehr im Überfluss zu leben, dass reihenweise Lebensmittel in der Tonne landen. Haben diese drei Monate meine Sicht auf die Welt geändert? Mich zu einem anderen Menschen gemacht? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sind es diese Augenblicke, die einen für einen kleinen Moment die Welt durch andere Augen sehen lassen, die uns ermöglichen eine andere Perspektive einzunehmen. Eindrücke, die Fragen aufwerfen, Zweifel, an der Art wie wir leben, was wir tun, oder eben gerade nicht tun. Augenblicke und Erfahrungen, die uns begleiten werden, uns bewusster werden lassen, und hoffentlich auch langfristig unser Handeln beeinflussen. Denn wir leben eben nicht in anderen Welten, so unterschiedlich die Kultur, das Zusammenleben, die Lebenssituation auch sein mag, sondern teilen einen Planeten, eine Welt.